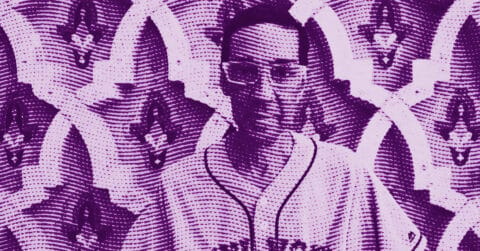Hört mir gut zu, ihr Snobs, William Morris ist nicht nur ein Glasmeister. Er ist ein Archäologe der Gegenwart, ein Schamane des geschmolzenen Materials, der Silizium zu kollektivem Gedächtnis verwandelt. Über fünfundzwanzig Jahre hinweg hat dieser 1957 in Carmel, Kalifornien, geborene Amerikaner die Grenzen des Glasblasens mit einer Kühnheit verschoben, die an mystische Genialität grenzt. Indem er seine Karriere 2007 im Alter von fünfzig Jahren auf dem Höhepunkt seines Ruhms beendete, hinterlässt Morris ein Werk, das über reine technische Virtuosität hinausgeht und eine anthropologische und spirituelle Dimension erreicht.
Die Kunst von William Morris steht im Zeichen einer grundlegenden Suche: die uralte Verbindung zwischen Mensch und Natur durch Objekte wiederzufinden, die so wirken, als kämen sie aus imaginären archäologischen Ausgrabungen. Seine Glas-Skulpturen fordern unsere Wahrnehmung heraus, indem sie sich als Knochen, Holz, Stein oder Keramik tarnen. Diese Täuschung ist kein bloßer technischer Kunstgriff, sondern eine tiefe Meditation über das Bleibende und Vergängliche, darüber, was die Zeit überdauert und was verschwindet.
Morris’ Weg beginnt unorthodox. Als keramischer Student ohne Geld und die nötigen Referenzen, um eine prestigeträchtige Glasschule zu besuchen, kommt er Ende der 1970er Jahre an die Pilchuck Glass School von Dale Chihuly. Im Austausch für seine Arbeit als LKW-Fahrer erhält er eine Ausbildung und lebt in einer Baumhütte. Diese bescheidene Anfangszeit prägt seinen Charakter und seine einzigartige Beziehung zum Material. Zehn Jahre lang wird er Chihulys Hauptglasmeister und nimmt viele Techniken auf, während er seine eigene ästhetische Vision entwickelt.
Im Gegensatz zu seinem Mentor, der Transparenz, Glanz und lebendige Farben bevorzugt, erforscht Morris bereits in seinen ersten persönlichen Werken die gedämpfteren Qualitäten von Glas. Seine Serie der Hohen Steine (Standing Stones) Mitte der 1980er Jahre leitet diesen einzigartigen Ansatz ein. Inspiriert von seinen Reisen in die Orkney- und Hebriden-Inseln mit Chihuly, erinnern diese monumentalen Skulpturen an vorkeltische Megalithen und erforschen gleichzeitig die skulpturalen Möglichkeiten von geschmolzenem Glas in Holzformen.
Die technische Entwicklung begleitet diese formale Forschung. Morris entwickelt mit seinem Team, insbesondere Jon Ormbrek und Karen Willenbrink-Johnsen, innovative Verfahren, die es ermöglichen, diese charakteristischen matten und strukturierten Oberflächen zu erzielen. Der Einsatz von farbigen Glaspulvern, Härteverfahren, Säurewaschungen und die Zusammenarbeit mit Pino Signoretto, einem Meisterglasbläser aus Murano, bereichern sein plastisches Vokabular. Diese Innovationen sind nie umsonst: Sie dienen einem kohärenten künstlerischen Projekt, das darauf abzielt, die Natur des verwendeten Materials zu vergessen.
Morris’ Werk findet seine konzeptuellen Wurzeln in zwei scheinbar entfernten Bereichen, die jedoch in einer gleichen existenziellen Sorge zusammenlaufen: Architektur und Literatur. Dieser doppelte Einfluss nährt seine Überlegungen über die Beständigkeit von Zivilisationen und die Weitergabe kollektiver Erinnerung.
Auf architektonischer Seite schöpft Morris seine Inspiration aus den megalithischen Monumenten, die er auf seinen europäischen Reisen entdeckt hat. Die Steinkreise von Stonehenge, die Ausrichtungen von Carnac, die bretonischen Dolmen: all dies sind Zeugnisse einer Menschheit, die bereits darauf aus war, ihre Präsenz für die Dauer festzuschreiben. Diese primitiven Architekturen, frei von jeglichem überflüssigen Schmuck, verkörpern für ihn die Essenz der Kunst: das Wesentliche mit minimalen Mitteln auszudrücken. Seine Standing Stones spiegeln diese Faszination in zeitgenössischen Begriffen wider, hinterfragen unser Verhältnis zum Heiligen in einer säkularisierten Gesellschaft.
Der Einfluss der Architektur endet nicht bei den alten Monumenten. Morris interessiert sich auch für die volkstümliche Architektur, anonyme Bauten, die eine perfekte Anpassung zwischen Mensch und Umgebung belegen. Die Lehmbauten Afrikas, die Inuit-Iglus, die Stelzenhäuser Polynesiens: all diese Modelle einer im Einklang mit der Natur stehenden Architektur inspirieren seine ambitioniertesten Installationen. Cache (1991), diese Ansammlung von Glas-Elefantenstoßzähnen, die gleichermaßen an ein Ossarium wie an einen Tempel erinnert, entspringt dieser Reflexion über die primitive Behausung und ihre symbolische Bedeutung.
Die Literatur bildet die zweite Säule seines konzeptuellen Ansatzes, insbesondere durch seine Auseinandersetzung mit Joseph Campbell und seine Forschungen zur vergleichenden Mythologie. Der Held mit den tausend Gesichtern und Die Masken Gottes bieten Morris einen theoretischen Rahmen, um die Konstanten menschlicher Erfahrung zu verstehen. Campbell zeigt, dass die Menschheit trotz kultureller Unterschiede einen gemeinsamen Fundus an Mythen und Symbolen teilt. Diese Universalität der Archetypen nährt direkt die Kunst von Morris, der sich weigert, sich auf eine bestimmte kulturelle Tradition zu beschränken, um frei aus dem symbolischen Erbe der Menschheit zu schöpfen.
Der Einfluss von Carl Jung, eine weitere grundlegende Interpretation, manifestiert sich in seinem Konzept des kollektiven Unbewussten. Für Jung besitzen bestimmte Bilder und Symbole eine universelle Resonanz, weil sie aus den tiefsten Schichten der menschlichen Psyche schöpfen. Die Hörner, Knochen, Masken, Graburnen, die die Welt von Morris bevölkern, funktionieren als jungi archetypische Symbole, die direkt mit unserem primitiven Unbewussten sprechen. Seine Jarres Canopes (Canopic Jars), inspiriert von ägyptischen Begräbnispraktiken, aber in einen zeitgenössischen Kontext übertragen, veranschaulichen diese kreative Aneignung universeller Symbole perfekt.
Die Literatur beeinflusst Morris auch in seiner Vorstellung von Zeit und Erinnerung. Wie Autoren, die zeitliche Schichten in ihren Werken erforschen, betrachtet Morris seine Skulpturen als visuelle Zeugnisse, in denen sich verschiedene Epochen überlagern. Seine Urnes Cinéraires (Cinerary Urns), ab 2002 entstanden nach dem Tod seiner Mutter und den Anschlägen vom 11. September, zeugen von dem Bestreben, zeitgenössische Erfahrungen in die Kontinuität der Ahnenrituale einzuschreiben. Diese Werke, formal verblüffend einfach, tragen die gesamte emotionale Belastung der modernen Literatur angesichts der Endlichkeit und der Trauer in sich.
Morris’ literarische Herangehensweise zeigt sich auch in seiner narrativen Konzeption der Skulptur. Im Gegensatz zu autonomen Werken, die für sich selbst stehen, funktionieren seine oft durch Verbindung und Suggestion. Seine Installationen folgen einer kumulativen Logik, die an Erzähltechniken erinnert: Wiederholung, Variation, Crescendo. Die Installation Mazorca (2003), mit ihren Hunderten hängenden Elementen, die sowohl an prä-hispanische Opfergaben als auch an polynesische Fischernetze erinnern, funktioniert wie ein episches Gedicht in drei Dimensionen, in dem jedes Element zu einem Gesamteffekt beiträgt.
Diese doppelte architektonische und literarische Ausbildung verleiht Morris’ Werk seine philosophische Dimension. Seine Skulpturen sind nicht nur schön oder technisch ausgefeilt: Sie stellen grundlegende Fragen zu unserer Beziehung zur Zeit, zum Tod, zur Transzendenz. Indem er aus Architektur und Literatur schöpft, überwindet Morris den traditionellen Rahmen der angewandten Kunst, um die Anliegen der großen zeitgenössischen Schöpfer aufzunehmen, die die menschliche Existenz durch ihr spezielles Medium hinterfragen.
Das auffälligste Merkmal von Morris’ Kunst liegt in seiner Fähigkeit, das Material zu täuschen. Seine Glasskulpturen erscheinen als alles Mögliche, nur nicht als Glas, sie stellen unsere Wahrnehmungsgewohnheiten infrage und hinterfragen die Natur der künstlerischen Darstellung selbst. Diese Verwandlung ist keine bloße technische Meisterleistung, sondern Ausdruck einer wahren Schöpfungsphilosophie.
Der Prozess beginnt mit der Ablehnung der traditionell mit Glas assoziierten Eigenschaften: Transparenz, Glanz, Helligkeit. Morris bevorzugt Opazität, Mattheit, gedämpfte Farben, die Erde und organische Materialien hervorrufen. Dieser kontraintuitive Ansatz ermöglicht es ihm, die skulpturalen Möglichkeiten des Mediums zu erforschen, ohne von seinen konventionellen Eigenschaften gefangen zu sein. Seine Rhytons, diese zoomorphen Gefäße, inspiriert von der antiken persischen Kunst, veranschaulichen diese Vorgehensweise perfekt: Sie besitzen die taktile Präsenz von Keramik, bewahren aber gleichzeitig die innere Leuchtkraft des Glases, die ihnen eine geheimnisvolle Aura verleiht.
Die Serie Artefakte (Artifacts), die ab den 1990er Jahren entwickelt wurde, treibt diese Logik auf die Spitze. Diese Ansammlungen von Objekten erinnern an die Bestände eines ethnologischen Museums oder die Funde einer archäologischen Ausgrabung. Jedes Element scheint von der Zeit patiniert und durch uralte Handhabungen abgenutzt zu sein. Die Illusion ist so perfekt, dass man näher herantreten und manchmal berühren muss, um die wahre Natur des Materials zu entdecken. Diese absichtliche Mehrdeutigkeit stellt unsere Beziehung zur Authentizität und Wahrheit in der Kunst in Frage. Morris erinnert uns daran, dass Kunst keine Nachbildung, sondern die Schaffung einer parallelen Realität ist, die ihre eigenen Gesetze besitzt. Wie er selbst sagt: “Ich interessiere mich nicht dafür, irgendetwas zu reproduzieren, sondern eher für den Eindruck von Dingen, Texturen, Farben, etwas, das Jahrhunderte lang in strengen und abgelegenen Orten überlebt hat” [1].
Die technische Virtuosität im Dienst dieser Vision erreicht mit der Serie Mensch Geschmückt (Man Adorned) von 2001 ihren Höhepunkt. Diese anthropomorphen Skulpturen, mit einem erstaunlichen Realismus, zeigen die absolute Beherrschung von Morris und seinem Team. Jedes Gesicht offenbart eine Persönlichkeit, eine ethnische Herkunft, eine individuelle Geschichte. Die anatomische Präzision misst sich mit der klassischen Statuenbildung, doch der Geist, der diese Werke belebt, gehört entschieden zur zeitgenössischen Kunst. Morris erforscht hier die Codes der Verzierung durch Kulturen hindurch und hinterfragt die Beziehungen zwischen individueller Identität und kollektiver Zugehörigkeit.
Diese Suche nach ursprünglicher Authentizität in einem entschieden modernen Medium offenbart die konzeptionelle Tiefe von Morris’ Vorhaben. “Der Glasblasprozess ist sehr demütig, und ich bin immer dankbar für alles, was ich mir erlauben kann zu tun. Glasblasen ist das, was der Alchemie, die ich kenne, am nächsten kommt” [2], gesteht er. Es handelt sich nicht um eine rückwärtsgewandte Nostalgie, sondern um den Versuch, in unserer Zeit zunehmender Virtualisierung die Wahrheit der Gesten und Materialien wiederzufinden. Seine Skulpturen funktionieren wie Anti-Bildschirme: Sie verlangen physische Präsenz, sprechen alle Sinne an und wecken in uns verborgene Erinnerungen.
William Morris hat das zeitgenössische Glas verwandelt, indem er seine unerwartetsten skulpturalen Potenziale offenbart hat. Sein Einfluss geht weit über den Kreis der Glasbläser hinaus und berührt die gesamte zeitgenössische Skulptur. Indem er zeigte, dass ein traditionell mit den dekorativen Künsten verbundenes Medium die tiefgründigsten Fragen der Konzeptkunst tragen kann, hat er einen neuen Weg eröffnet, der heute noch viele Schöpfer inspiriert.
Seine Entscheidung, die Produktion mit fünfzig Jahren, auf dem Höhepunkt seiner internationalen Anerkennung, einzustellen, ist an sich ein künstlerischer Akt. “Ich habe immer gesagt, wenn ich alles tun könnte, was ich wollte, was wäre das? Und es war nicht, mit Glas aufzuhören, weil ich es nicht mochte oder nicht fasziniert davon war. Es ist einfach etwas, das ich so intensiv so lange gemacht habe” [3], erklärt er. Morris verweigerte die Logik der Überproduktion, die jeden erfolgreichen Künstler bedroht, und zog es vor, die Integrität seines Werks zu bewahren. Diese Ethik der Seltenheit, diese Philosophie der Mäßigung knüpft an seinen Ansatz an: Das Wesentliche dem Unwesentlichen, die Qualität der Quantität vorzuziehen.
Das Werk von William Morris erinnert uns daran, dass wahre Kunst nicht in der Beherrschung einer Technik liegt, so perfekt sie auch sein mag, sondern in der Fähigkeit, diese Technik in eine persönliche Sprache zu verwandeln. Indem er Glas in ein kollektives Gedächtnis verwandelte und Virtuosität in Poesie verwandelte, schuf Morris ein einzigartiges plastisches Universum, das uns weiterhin berührt und zum Nachdenken anregt. In einer Epoche, die von Neuheit und technologischer Innovation besessen ist, führen uns seine Skulpturen zurück zu den Ursprüngen der menschlichen Erfahrung, zu jenen ersten Gesten, die unsere Menschlichkeit begründen.
Sein derzeitiges Schweigen ist kein Rückzug, sondern eine Vollendung. “Ein Objekt erzählt eine Geschichte, ob gefunden oder gefertigt. Es erzählt die Geschichte seines Ursprungs, seines Prozesses und erleuchtet uns über etwas, das außerhalb von uns liegt”[4], fasst Morris zusammen. Wie jene namenlosen Handwerker antiker Zivilisationen, die er so bewundert, hinterließ Morris der Menschheit Objekte, die ihre Zeit übersteigen, um das Universelle zu erreichen. Diese zeitgenössischen Artefakte werden uns noch lange von uns selbst, unseren Ängsten und unseren tiefsten Hoffnungen erzählen.
- William Morris, zitiert in “Petroglyphs in Glass”, Wheaton Museum of American Glass, September 2020
- William Morris, Interview in “Oral history interview with William Morris”, Archives of American Art, Smithsonian Institution, Juli 2009
- William Morris, zitiert in “The Art of William Morris”, Glass Art Magazine, Bd. 4, 2001
- William Morris, künstlerische Aussage in “William Morris : Early Rituals”, Museum of Northern Arizona, Juni 2024